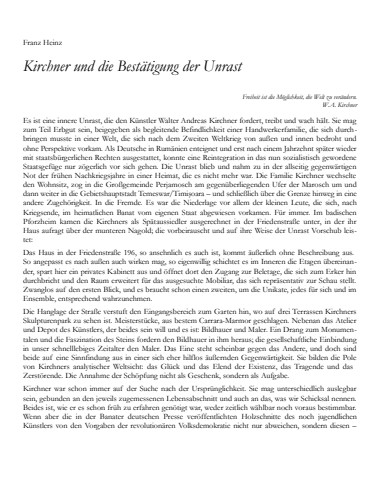Page 7 - Demo
P. 7
Franz HeinzKirchner und die Best%u00e4tigung der UnrastFreiheit ist die M%u00f6glichkeit, die Welt zu ver%u00e4ndern.W.A. KirchnerEs ist eine innere Unrast, die den K%u00fcnstler Walter Andreas Kirchner fordert, treibt und wach h%u00e4lt. Sie magzum Teil Erbgut sein, beigegeben als begleitende Befindlichkeit einer Handwerkerfamilie, die sich durchbringen musste in einer Welt, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg von au%u00dfen und innen bedroht undohne Perspektive vorkam. Als Deutsche in Rum%u00e4nien enteignet und erst nach einem Jahrzehnt sp%u00e4ter wiedermit staatsb%u00fcrgerlichen Rechten ausgestattet, konnte eine Reintegration in das nun sozialistisch gewordeneStaatsgef%u00fcge nur z%u00f6gerlich vor sich gehen. Die Unrast blieb und nahm zu in der allseitig gegenw%u00e4rtigenNot der fr%u00fchen Nachkriegsjahre in einer Heimat, die es nicht mehr war. Die Familie Kirchner wechselteden Wohnsitz, zog in die Gro%u00dfgemeinde Perjamosch am gegen%u00fcberliegenden Ufer der Marosch um unddann weiter in die Gebietshauptstadt Temeswar/Timi%u015foara %u2013 und schlie%u00dflich %u00fcber die Grenze hinweg in eineandere Zugeh%u00f6rigkeit. In die Fremde. Es war die Niederlage vor allem der kleinen Leute, die sich, nachKriegsende, im heimatlichen Banat vom eigenen Staat abgewiesen vorkamen. F%u00fcr immer. Im badischenPforzheim kamen die Kirchners als Sp%u00e4taussiedler ausgerechnet in der Friedenstra%u00dfe unter, in der ihrHaus aufragt %u00fcber der munteren Nagold; die vorbeirauscht und auf ihre Weise der Unrast Vorschub leistet:Das Haus in der Friedenstra%u00dfe 196, so ansehnlich es auch ist, kommt %u00e4u%u00dferlich ohne Beschreibung aus. So angepasst es nach au%u00dfen auch wirken mag, so eigenwillig schichtet es im Inneren die Etagen %u00fcbereinander, spart hier ein privates Kabinett aus und %u00f6ffnet dort den Zugang zur Beletage, die sich zum Erker hindurchbricht und den Raum erweitert f%u00fcr das ausgesuchte Mobiliar, das sich repr%u00e4sentativ zur Schau stellt.Zwanglos auf den ersten Blick, und es braucht schon einen zweiten, um die Unikate, jedes f%u00fcr sich und imEnsemble, entsprechend wahrzunehmen.Die Hanglage der Stra%u00dfe verstuft den Eingangsbereich zum Garten hin, wo auf drei Terrassen KirchnersSkulpturenpark zu sehen ist. Meisterst%u00fccke, aus bestem Carrara-Marmor geschlagen. Nebenan das Atelierund Depot des K%u00fcnstlers, der beides sein will und es ist: Bildhauer und Maler. Ein Drang zum Monumentalen und die Faszination des Steins fordern den Bildhauer in ihm heraus; die gesellschaftliche Einbindungin unser schnelllebiges Zeitalter den Maler. Das Eine steht scheinbar gegen das Andere, und doch sindbeide auf eine Sinnfindung aus in einer sich eher hilflos %u00e4u%u00dfernden Gegenw%u00e4rtigkeit. Sie bilden die Polevon Kirchners analytischer Weltsicht: das Gl%u00fcck und das Elend der Existenz, das Tragende und das Zerst%u00f6rende. Die Annahme der Sch%u00f6pfung nicht als Geschenk, sondern als Aufgabe.Kirchner war schon immer auf der Suche nach der Urspr%u00fcnglichkeit. Sie mag unterschiedlich auslegbarsein, gebunden an den jeweils zugemessenen Lebensabschnitt und auch an das, was wir Schicksal nennen.Beides ist, wie er es schon fr%u00fch zu erfahren gen%u00f6tigt war, weder zeitlich w%u00e4hlbar noch voraus bestimmbar.Wenn aber die in der Banater deutschen Presse ver%u00f6ffentlichten Holzschnitte des noch jugendlichenK%u00fcnstlers von den Vorgaben der revolution%u00e4ren Volksdemokratie nicht nur abweichen, sondern diesen %u2013